Wenn Journalisten und Wissenschaftler sich begegnen, blicken sie sich oft mit einer Mischung aus Respekt, Verwunderung und leisem Misstrauen an. Beide lieben die Wahrheit – zumindest behaupten sie das. Doch ihre Wege zu dieser Wahrheit könnten unterschiedlicher kaum sein.
Der Journalist jagt die Geschichte. Am liebsten aktuell, dramatisch und klickstark. Die Wissenschaftlerin hingegen züchtet ihre Erkenntnis wie ein Bonsai: langsam, vorsichtig, mit viel Geduld – und unter ständiger Beobachtung. Während der Journalist schon auf „Veröffentlichen“ klickt, ist die Wissenschaftlerin noch damit beschäftigt, den Unterschied zwischen „signifikant“ und „relevant“ zu erklären – zum dritten Mal, im Kleingedruckten.
Gemeinsamkeiten gibt es trotzdem:
Beide Berufsgruppen lieben Zitate. Beide führen Interviews. Beide glauben, dass sie aufklären – und beide schreiben über Dinge, die sie manchmal selbst nicht ganz verstehen. Während der Wissenschaftler aber eine Fußnote schreibt, schreibt der Journalist: „Wie eine Studie nahelegt…“ – und überlässt es dem Leser, ob diese „Studie“ tatsächlich existiert.
In der journalistischen Welt zählt Geschwindigkeit. Fakten müssen schnell geprüft, Aussagen sofort eingeordnet, Experten direkt zitiert werden – ob sie es wollen oder nicht. In der Wissenschaft dagegen gilt: Wenn du in unter zwei Jahren veröffentlichst, hast du wahrscheinlich etwas übersehen.
Der Umgang mit Wahrheit?
Nun ja. Die Wissenschaft ringt mit ihr. Sie stellt Hypothesen auf, widerlegt sie, stellt neue auf – und freut sich über Widerspruch. Der Journalismus hingegen macht aus jeder These sofort eine Headline. Aus „Ein möglicher Zusammenhang“ wird „Schokolade heilt Corona“. Und sollte sich das später als falsch herausstellen, folgt die Richtigstellung in Schriftgröße 8 auf Seite 17, unter dem Kreuzworträtsel.
Und dann wären da noch die Halbwahrheiten…
Im Journalismus heißen sie „zugespitzt“, „vereinfachend“ oder „der Dramaturgie geschuldet“. In der Wissenschaft nennt man sie „methodische Einschränkungen“, „statistische Unschärfen“ oder – mein Favorit – „es bedarf weiterer Forschung“. Das ist die akademische Version von „Wir wissen es auch nicht so genau, aber wir tun es mit Format.“
Fake News haben inzwischen Karriere gemacht. Sie sind längst nicht mehr nur in dunklen Foren unterwegs, sondern tragen Anzug und werden in Talkshows eingeladen. Der Unterschied zur wissenschaftlichen Fehlannahme? Letztere wird widerrufen. Die Fake News bleibt – und hat mittlerweile mehr Follower als jede Universität.
Und was ist mit dem Leser?
Der ist inzwischen verwirrt. Hat Kaffee jetzt Antioxidantien oder ist er krebserregend? Sollten wir mehr schlafen oder morgens um 5 joggen? Und warum sagt der Professor das Gegenteil vom „Experten“ in der Talkrunde? Nun, vielleicht weil Wissenschaft auf Differenzierung beruht – und Journalismus auf Aufmerksamkeit.
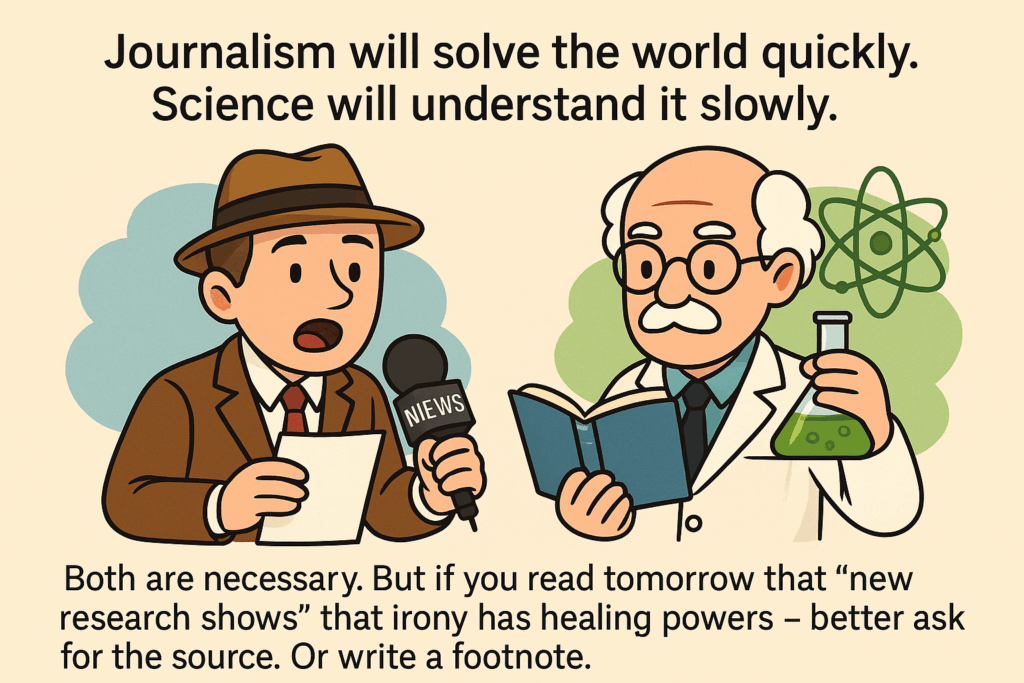
Aber bevor wir uns in Elfenbeintürmen oder Redaktionsstuben vergraben: Beide haben ihre Berechtigung. Der Journalismus informiert (meistens), die Wissenschaft erklärt (mit Geduld). Beide können uns helfen, die Welt besser zu verstehen – wenn sie sich gegenseitig zuhören.
Fazit mit einem Augenzwinkern:
Journalismus will die Welt schnell erklären. Wissenschaft will sie langsam verstehen. Beides ist notwendig. Aber wenn Sie morgen lesen, dass „neue Forschung zeigt“, dass Ironie heilend wirkt – fragen Sie besser nach der Quelle. Oder schreiben Sie eine Fußnote.
